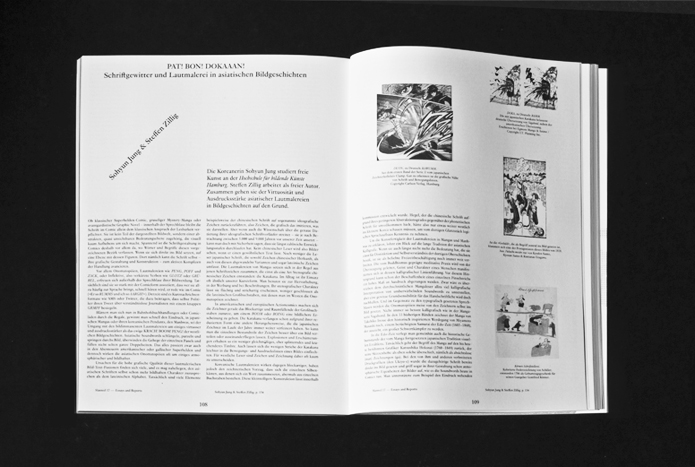PAT! BON! DOKAAAN! – Schriftgewitter und Lautmalerei in asiatischen Bildgeschichten
Das aktuelle Slanted Magazin #17 beschäftigt sich mit dem großen und bunten Themenfeld Cartoon und Comic. Einen Teil der lesenswerten Essays und Reports der neuen Ausgabe möchten wir auch mit euch, unseren Blog-Lesern, teilen. Aus diesem Grund starten wir heute mit einer kleinen Reihe von Artikeln, die im aktuellen Slanted Magazin in gedruckter Form präsentiert werden. Den Anfang machen Sohyun Jung und Steffen Zillig, die sich in ihrem Essay intensiv mit Lautmalereien und Soundwords in asiatischen Bildgeschichten auseinandergesetzt haben.
Steffen Zillig ist Künstler und Autor. Er studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er schreibt für Texte zur Kunst, art – Das Kunstmagazin und Kultur & Gespenster. Sein Buch Albrecht erschien im Februar 2012 im Rhein-Verlag. Er lebt in Hamburg.
Sohyun Jung studierte Freie Kunst an der Ewah Womans University in Seoul, Südkorea und der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Seit 2011 betreibt sie das koreanisch-deutsche Weblog Kunst/slash – Translate German Art. Sie lebt als freie Künstlerin, Illustratorin und 3D-Grafikerin in Hamburg.
PAT! BON! DOKAAAN! –
Schriftgewitter und Lautmalerei in asiatischen Bildgeschichten
Ob klassischer Superheldencomic, gruseliger Mystery-Manga oder avantgardistische Graphic Novel – innerhalb der Sprechblase bleibt die Schrift im Comic allein dem klassischen Anspruch der Lesbarkeit verpflichtet. Sie ist kein Teil der dargestellten Bildwelt, sondern einer abstrakten, quasi unsichtbaren Bedeutungsebene zugehörig, die visuell kaum Aufhebens um sich macht. Spannend ist die Schriftgestaltung in Comics deshalb vor allem da, wo Wörter und Begriffe diesen vorgezeichneten Bezirk verlassen. Wenn sie sich direkt ins Bild setzen, auf eine Ebene mit dessen Figuren. Dort nämlich kann die Schrift selbst – ihre grafische Gestaltung und Konstruktion – zum aktiven Komplizen der Handlung avancieren.
Vor allem Onomatopöien, Lautmalereien wie PENG, POFF und ZACK, oder Inflektive, also verkürzte Verben wie GLOTZ oder GRÜBEL, erfreuen sich außerhalb der Sprechblase ihrer Bildwerdung. Tatsächlich sind sie so stark mit der Comicform assoziiert, dass wer sie allzu häufig zur Sprache bringt, schnell hören wird, er rede wie im Comic (»Er so RUMMS und ich so AARGH!«). Derzeit sind es Kurznachrichtenformate wie SMS oder Twitter, die dazu beitragen, dass selbst Politiker ihren Tweet über verständnislose Journalisten mit einem knappen GRMPF besiegeln.
Blättert man sich nun in Bahnhofsbuchhandlungen oder Comicläden durch die Regale, gewinnt man schnell den Eindruck, in japanischen Mangas oder ihren koreanischen Pendants, den Manhwas, sei der Umgang mit den bildimmanenten Lautmalereien um einiges virtuoser und ausdrucksstärker als das ewige KRACH! BOOM! PENG! der westlichen Bildgeschichten. Asiatische Soundwords schlängeln, purzeln und springen durchs Bild, überwinden die Gehege der einzelnen Panels und füllen nicht selten ganze Doppelseiten. Das alles passiert zwar auch in den Abenteuern amerikanischer oder gallischer Superhelden und dennoch wirken die asiatischen Onomatopöien oft um einiges atmosphärischer und bildhafter.
Ursachen für die hohe grafische Qualität dieser lautmalerischen Bild-Text-Fusionen finden sich viele, und es mag naheliegen, den asiatischen Schriften selbst schon mehr bildhaften Charakter zuzusprechen als dem lateinischen Alphabet. Tatsächlich sind viele Elemente beispielsweise der chinesischen Schrift auf sogenannte ideografische Zeichen zurückzuführen, also Zeichen, die grafisch das imitieren, was sie darstellen. Aber wenn auch die Wissenschaft über die genaue Datierung ihrer ideografischen Schriftvorläufer streitet – sie je nach Betrachtung zwischen 5.000 und 9.000 Jahren vor unserer Zeit ansetzt – kann man doch mit Sicherheit sagen, dass sie längst zahlreiche Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Kein chinesischer Leser wird also Bilder sehen, wenn er einen gewöhnlichen Text liest. Noch weniger die Leser japanischer Schrift, die sowohl Zeichen chinesischer Herkunft, als auch von diesen abgewandelte Varianten und sogar lateinische Zeichen umfasst. Die Lautmalereien von Mangas setzen sich in der Regel aus jenen Schriftzeichen zusammen, die einst als eine Art Stenografie chinesischer Zeichen entstanden: die Katakana. Im Alltag ist ihr Einsatz oft ähnlich unserer Kursivform. Man benutzt sie zur Hervorhebung, in der Werbung und bei Beschriftungen. Ihr stenografischer Charakter lässt sie flüchtig und strichartig erscheinen, weniger geschlossen als die lateinischen Großbuchstaben, mit denen man im Westen die Onomatopöien zeichnet.
In amerikanischen und europäischen Actioncomics machen sich die Zeichner gerade das Blockartige und Raumfüllende der Großbuchstaben zunutze, um einem BOOM oder BOING eine bildlichere Erscheinung zu geben. Die Katakana verlangen schon aufgrund ihrer reduzierten Form eine andere Herangehensweise, die die japanischen Zeichner im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert haben. So kann man die einzelnen Bestandteile der Zeichen besser über ein Bild verteilen oder auseinanderfliegen lassen. Explosionen und Erschütterungen erhalten so ein weniger gleichmäßiges, eher splitterndes und krachenderes Timbre. Auch lassen sich die wenigen Striche der Katakana leichter in die Bewegungs- und Ausdruckslinien eines Bildes einflechten. Für westliche Leser sind Zeichen und Zeichnung daher oft kaum zu unterscheiden.
DUON, zu Deutsch: KAWUMM. Aus dem ersten Band der Serie X vom japanischen Zeichnerkollektiv Clamp. Gut zu erkennen ist die grafische Nähe von Schrift und Bewegungslinien (© Carlson Verlag, Hamburg)
Koreanische Lautmalereien wirken dagegen blockartiger, haben jedoch den zeichnerischen Vorzug, dass sich die einzelnen Silbenkästen, aus denen sich ein Wort zusammensetzt, abermals aus einzelnen Buchstaben bestehen. Diese kleinteiligere Konstruktion lässt innerhalb des Bildes auch mehr Möglichkeiten, Begriffe gestalterisch zu zerlegen und umzustellen. Ein zur Silbe gehöriger Kreis lässt sich beispielsweise statt unter den Zeichenkörper ebenso gut rechts daneben platzieren. Entgegen dem geläufigen Vorurteil vom bildhaften Charakter asiatischer Schriften ist die koreanische übrigens eine reine Buchstabenschrift, die erst im 15. Jahrhundert am Schreibtisch einer königlichen Expertenkommission entwickelt wurde. Hegel, der die chinesische Schrift aufgrund ihres geringeren Abstraktionsgrades gegenüber der phonetischen Schrift für unvollkommen hielt, hätte also nur etwas weiter westlich ins kleinere Korea schauen müssen, um vom dortigen Glanzstück logischen Sprachaufbaus Kenntnis zu nehmen.
Um die Kunstfertigkeit der Lautmalereien in Mangas und Manhwas zu erklären, lohnt ein Blick auf die lange Tradition der asiatischen Kalligrafie. Wenn sie auch längst nicht mehr die Bedeutung hat, den sie einst für Distinktion und Selbstverständnis der dortigen Oberschichten besaß, ist sie als beliebte Freizeitbeschäftigung noch immer weit verbreitet. Die vom Buddhismus geprägte meditative Praxis wird von der Überzeugung geleitet, Geist und Charakter eines Menschen manifestierten sich in dessen kalligrafischer Linienführung. Vor diesem Hintergrund kann schon der Beschaffenheit eines einzelnen Pinselstrichs ein hohes Maß an Ausdruck abgerungen werden. Zwar wäre es übertrieben dem durchschnittlichen Mangaleser allzu viel kalligrafische Interpretation von umherwirbelnden Soundwords zu unterstellen, aber eine gewisse Grundsensibilität für das Handschriftliche wird doch nachhallen. Und im Gegensatz zu den typografisch gesetzten Sprechblasen werden die Onomatopöien meist von den Zeichnern selbst ins Bild gesetzt. Nicht immer so betont kalligrafisch wie in der Mangaserie Vagabond. In den 33 bisherigen Bänden zeichnet der Manga von Takehiko Inoue den historisch inspirierten Werdegang von Miyamoto Musashi nach, einem berüchtigten Samurai der Edo-Zeit (1603–1868), der auszieht, ein großer Schwertkämpfer zu werden.
DOKA, zu Deutsch: BAMM Die mit japanischen Katakana belassene deutsche Übersetzung von Vagabond, neben der amerikanischen Übersetzung. (erschienen bei Egmont Manga & Anime / © I.T. Planning Inc.)
In die Edo-Zeit verlegt man gemeinhin auch die historische Geburtstunde der vom Manga fortgesetzten japanischen Tradition visuellen Erzählens. Tatsächlich geht der Begriff des Manga auf den bis heute berühmten Grafiker Katsushika Hokusai (1760–1849) zurück, der seine Skizzenhefte als eben solche überschieb, nämlich als absichtslose (man) Zeichnungen (ga). Bei den von ihm und anderen verbreiteten Druckgrafiken (den Ukiyo-e) wurde die dazugehörige Schrift bereits direkt ins Bild gesetzt und griff sogar in ihrer Gestaltung schon atmosphärische Eigenheiten der Bilder auf, wie es die Soundwords heute in Comics tun. Man unterstützte zum Beispiel den Eindruck wehenden Windes durch eine wellenartige Laufrichtung des Textes. Auch die für die Bildsprache der Mangas so unverzichtbaren Bewegungslinien finden sich bereits; und wenn es auch noch keine lautmalerischen Darstellungen von Geräuschen gab, so doch Schlüsselbegriffe eines Textes, die an zentraler Stelle direkt mit den Figuren des Bildes interagierten. Wie sehr Bild und Text schon im damaligen Japan als visuelle Einheit begriffen wurden, lässt sich auch daran erkennen, dass man, obwohl die Technik des Typendrucks längst bekannt war, lange am älteren Blockdruckverfahren festhielt, da man mit diesem Bild und Text in einem Arbeitsschritt anfertigen konnte.
An die »Geduld«, die als Begriff zentral ins Bild gesetzt ist, klammert sich einer Protagonisten dieses Bildes von 1818 (Aus Fukuchu meisho zue von Kyoden Santo, Kyozan Santo & Kunianao Utagawa)
Körners Schriftstellerei (Kolorierte Federzeichnung von Schiller, entstanden 1786 als Geburtstagsgeschenk für seinen Gastgeber Gottfried Körner)
Man kann dieses historisch gewachsene Bildverständnis, das die Schrift eben nicht als Fremdkörper begreift, sicher als Grundlage für die dynamische Schriftgestaltung heutiger Mangas sehen. Falsch wäre es aber, die Vorläufer der Mangas allein im asiatischen Raum zu suchen. Denn es waren nicht zuletzt die europäischen Karikaturen des 18. Jahrhunderts, die in vielerlei Hinsicht wegweisend waren für die Entwicklung der ihrer Erzählform. Sequenzbasierte Bildreihen, die Einteilung in einzelne Panels und sogar Sprechblasen kamen hier bereits zum Einsatz. Sogar Friedrich Schiller dürfte sich guten Gewissens in die Reihe europäischer Wegbereiter stellen, hinterließ er doch eine Zeichnung, die in Aufmachung und Gestaltung durchaus an die heutige Comicform erinnert. In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts waren es vor allem die Karikaturen britischer und französischer Zeitungen, die in Japan für dort ansässige Europäer verlegt wurden, die die einheimischen Zeichner inspirierten. Selbst die frühen Arbeiten von Manga-Legende Tezuka Osamu, der mit Serien wie Astro Boy nach dem zweiten Weltkrieg entscheidend zur anhaltenden Popularität der Mangas beitrug, erinnern stark an ihre amerikanischen Vorbilder. Auch die japanische Lautmalerei zeigte damals noch wenig von ihrer heutigen Kunstfertigkeit.
Szene aus dem dritten in Deutschland erschienen Band von Astro Boy, dessen Gestaltung sich noch stark an amerikanischen Superhelden orientiert (© Carlson Verlag, Hamburg)
Für die Dynamik von Onomatopöien im Manga war aber weniger der westliche Einfluss entscheidend, als vielmehr das, was die asiatischen Zeichner aus ihm heraus entwickelten. Voran ging eine Diversifizierung der Leserschaft. Schon Tezuka Osamu begann in den fünfziger Jahren mit speziellen Mangaserien für Mädchen, was einem Startschuss für die Erfindung immer neuer Subgenres mit immer neuen Zielgruppen gleichkam. Anders die Comics in Europa und Amerika, wo sich in erster Linie Jungen und junge Männern für längere Bildgeschichten begeistern konnten. In der Folge diversifizierten sich auch die Erzählformen der asiatischen Comics. Man begann aus der konventionellen Panelaufteilung auszubrechen, kleine und große, gerahmte und ungerahmte Panels zu kombinieren. Die Perspektivwechsel wurden filmischer, und auch die für Manga typische Dehnung der Erzählzeit ließ den Comic naher an den Film heranrücken. Auch die Soundwords lassen sich als Kompensation einer fehlenden akustischen Sinnebene verstehen, wie sie das Kino mit sich brachte.
Bei Silent Möbius behalten SWISH und CLICK auch in lateinischer Schriftform japanischen Charakter (© Plantet Manga / Panini Comics)
Untertitelung: Im japanischen verlaufen die Schriftzeichen links und rechts parallel zum Torbogen. Die Übersetzung – ein knappes DOOM! – kann dagegen keine visuelle Verbindung zum Bildmotiv knüpfen (aus Bleach, Band 10, erschienen bei Tokyopop Hamburg)
Wie beim Film gibt es auch beim Manga unterschiedliche Auffassungen über richtige Form der Übersetzung. Stellt sie innerhalb der Sprechblase noch eine lösbare Aufgabe dar, wird es bei der Lautmalerei schon komplizierter. Nicht nur weil sich Vieles nur mit Mühe aus seinen kompositorischen Zusammenhängen lösen lässt, gerade die beschriebenen Eigenarten japanischer Schriftzeichen sind mit lateinischen Großbuchstaben nur schwer zu imitieren. Doch gibt auch erfreuliche Ausnahmen, wie Kia Asamiyas Science-Fiction-Reihe Silent Möbius, dessen Angleichung der lateinischen Schriftzeichen an die kantige Erscheinung der Katakana erstaunlich authentisch wirkt. Von Verkaufsschlagern wie One Piece oder Dragonball einmal abgesehen, werden heute immer mehr Lautmalereien schlichtweg untertitelt. In ihrer direkten Gegenüberstellungen wirkt ein lateinisch gesetztes DOMM oder WAMM zwar grafisch umso ärmlicher, gleichwohl muss nicht mehr auf die ursprüngliche Komposition verzichtet werden – wie im Kino, wo die Liebhaber auch lieber den durch Untertitel gestörten Bildgenuss in Kauf nehmen, als bei Schauspiel und Akustik Abstriche zu machen. Bei einigen Reihen, wie beim bereits erwähnten Vagabond, spart man die Übersetzungen der Onomatopöien gleich ganz, wohl weil man ihren grafischen Charakter atmosphärisch wichtiger findet als ihren phonetischen. So drosselt man gleichsam die Lautstärke der Leseerfahrung – nicht immer zum Nachteil mancher in Sachen Action noch ungeübten westlichen Leser.
SPANNUNG! Ersetzt in der deutschen Übersetzung des Erfolgsmangas One Piece das japanische BAAAAAAN! Neben den Soundwords treten in Mangas auch andere Begriffe ins Bild, die die Atmosphäre stützen sollen (© Carlson Verlag, Hamburg)
Dass Mangas und Manhwas auf akustischer Ebene oft viel dynamischer erzählt werden als die westlichen Comics, mag neben der speziellen Beschaffenheit ihrer Schriftzeichen, der langen Tradition von Kalligrafie und Bild-Text-Kombinationen sowie den mangaspezifischen Erzählformen auch im grundsätzlichen Reichtum von Eigenschaftswörtern etwa für Bewegungsarten (tippelnd, schleichend, etc.) oder Konsistenzen (weich, glibberig, etc.) begründet liegen, die die japanische und die koreanische Sprache bereit halten. Darüber hinaus werden in Mangas auch durchaus paradox anmutende Lautmalereinen ins Bild gesetzt, TOTENSTILLE etwa. Auch Begriffe, die eher die Atmosphäre eines Panels einfangen, als dass sie ein Geräusch darstellen. SPANNUNG ist so ein aus europäischer Perspektive merkwürdig anmutender Begriff, dessen verlängertes japanisches Äquivalent ungleich klangvoller erscheint: BAAAAAN! Möglicherweise harren auch einige dieser Begriffe nur ihrer lautmalerischen Einbürgerung. Bisher jedenfalls fehlt dem Manga das diesbezügliche Talent einer Erika Fuchs. Die legendäre Übersetzerin und einstige Chefredakteurin der deutschen Mickey Mouse zeichnete in der Nachkriegszeit für eine ganze Reihe großartiger deutscher Lautmalereien verantwortlich: Aus dem amerikanischen KA-RASH beispielsweise wurde bei ihr ein deutsches KLICKERADOMS.
In Muhan Dochon, einer südkoreanischen Fernsehshow werden die Protagonisten durchgehend von comicartigen Symbolen und Bilduntertiteln umringt. (© MBC)
Craig Thompsons Habibi erzählt die Geschichte zweier Sklavenkinder in opulenten Bildern. Auch europäische Zeichner verstehen den virtuosen Umgang mit Schrift im Bild (erschienen im Reprodukt Verlag Berlin)
Aber so fantastisch diese und andere Wortschöpfungen anmuten, halten die wenigsten von ihnen Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch – wenn ein getwittertes GRMPF auch immerhin ein Anfang ist. In Ostasien ist das gesamte Alltagsleben vielmehr von Schrift und speziell auch von Lautmalerei durchzogen als hierzulande. Das gilt nicht nur für das Straßenbild oder die omnipräsenten Werbebotschaften, auch Fernsehsendungen werden häufig mit Schrifteinblendungen begleitet, um das gezeigte Geschehen zusätzlich zu kommentieren. In Muhan Dochon beispielsweise, einer der populärsten Fernsehshows in Südkorea, werden die Sketche permanent von comicartigen Symbolen und Onomatopöien durchzogen: GLOTZ steht dann im Bildschirmvordergrund, wenn die Protagonisten dahinter in eine Richtung starren. Aber auch ohne eine solche alltägliche Zeichenflut schaffen es auch immer mehr europäische und amerikanische Zeichner ihrem Umgang mit Schrift neue darstellerische Ebenen abzugewinnen. So bei Habibi, dem kürzlich auf Deutsch erschienenen 700-Seiten-Epos des Amerikaners Craig Thompson. Den kalligrafischen Strang seiner orientalischen Erzählung setzt er häufig mit beeindruckendem Gespür für Komposition und das Ineinanderfließen von Bedeutungsschichten ins Bild, etwa dann, wenn er arabischen Schriftzeichen über die ganze Seite verteilt in rauchartiges Ornament aufgehen lässt. Das Potential jener den Sprechblasen entkommenen Schrift, deren Aufwertung die Mangas Bahn brachen, es scheint noch längst nicht ausgeschöpft.